
Im März ist eine Novelle zum Bundesvergabegesetz in Kraft getreten. Darin sind diverse Regelungen zur Umsetzung von Gemeinschaftsrecht und einige Regelungen mit der Zielsetzung der Vereinfachung und Kostenersparnis enthalten.
Mit der erwähnten Novelle wurde aufgrund von Erhebungen über die Kosten von Vergabeverfahren ohne EU-richtlinienbedingte Not die sogenannte Eigenerklärung in das Bundesvergabegesetz und somit in das Vergabeverfahren eingeführt. Dabei geht es um die vom Auftraggeber zu prüfende und vom Bieter nachzuweisende Eignung des Bieters, einen bestimmten zu vergebenden Auftrag ausführen zu können. Das Gesetz sieht dafür eine ganze Latte an vorzulegenden Nachweisen vor, angefangen bei Strafregisterauszügen, über Umsatzangaben, Bilanzen, Firmenbuch- und Gewerberegisterauszügen, Bankauskünften, Referenzlisten, Angaben über den Gerätepark bis hin zu Ausbildungsnachweisen und Angaben über die Arbeitnehmerzahl etc. Diese Unterlagen beizubringen, so dachte der Gesetzgeber, sei für die Bieter mit hohen Kosten und für die Auftraggeber mit hohem Prüfaufwand verbunden. Statt nun von den Bietern die Vorlage all dieser Nachweise gleich zu verlangen, dürfen die Bieter nunmehr erklären, dass sie über die erforderlichen Befugnisse verfügen (diese, also z.B. die vorhandenen Gewerbeberechtigungen, müssen auch aufgezählt werden – wofür das gut sein soll, weiß man nicht genau) sowie die technische und wirtschaftliche bzw. finanzielle Leistungsfähigkeit aufweisen und auch zuverlässig sind (was in der vergaberechtlichen Sprache heißt, dass sie nichts auf dem Kerbholz haben, was sie von öffentlichen Aufträgen ausschlösse). Erst in einem weiteren Schritt kann dann der Auftraggeber zur Vorlage von Nachweisen auffordern, wofür er eine Frist zu setzen hat; die Gesetzesmaterialien merken dazu an, dass dafür ein Tag ausreichend sei, weil die Eigenerklärung auch die Zusage enthalten müsse, zum Eignungsnachweis in der Lage zu sein. Der Auftraggeber ist (außer bei Aufträgen mit vergleichsweise niedrigem Auftragswert) nur verpflichtet, von dem Bieter, an den er den Zuschlag erteilen will, die Nachweise auch tatsächlich einzufordern, bei allen anderen kann er theoretisch auch davon absehen. Der Auftraggeber braucht auch nicht alle Nachweise, die er in den Ausschreibungsunterlagen erwähnt hat, anzufordern, sondern er kann hier von Bieter zu Bieter entscheiden, was er sehen will und was er nicht braucht.
Diese neue Regelung ist aus mehreren Gründen missglückt und läuft Gefahr, sich mittelfristig als Totgeburt zu erweisen. Erstens: Auftraggeberseitig. Angesichts des immer größer werdenden Volumens der Beschaffungsvorgänge nicht nur in Summe, sondern auch der einzelnen Projekte und der damit schon im Vergabeprozess verbundenen Kosten für Planung, Ausschreibung, Angebotserstellung etc., wird es für Auftraggeber nur schwer vertretbar sein, sich auf Eigenerklärungen der Bieter zu verlassen, ohne nähere Überprüfungen anzustellen. Geht dann nämlich etwas schief, wird er sich – nicht zuletzt medial – mit der Frage konfrontiert sehen, weshalb er nicht näher hingesehen hat. Zweitens: Bieterseitig. Wo für die Bieter die große Erleichterung liegen soll, zunächst die Eigenerklärung abzugeben, aber die Unterlagen sowieso griffbereit vorrätig zu halten, ist fraglich. Anscheinend dachte der Gesetzgeber bei seinen Einsparungsbemühungen an die Auftraggeber mehr als an die Bieter. Darüber hinaus stellt die – frei formulierbare – Eigenerklärung auch ein Risiko für den Bieter dar: Was, wenn sie dem Auftraggeber nicht ausreicht? (Aus praktischen Gründen ist damit zu rechnen, dass die Auftraggeber in den Ausschreibungsunterlagen die Formulierung der Eigenerklärung vorgeben werden.) Stattdessen wäre eine klarere Regelung, welche Nachweise für welche Vergabeverfahren verlangt werden sollten, wünschenswert gewesen. Drittens: Strukturell. Das Vergaberecht trennt, wie der Europäische Gerichtshof immer wieder betont hat, die Eignungsprüfung von der Angebotsprüfung. Zuerst findet die Eignungsprüfung statt, dann die Angebotsprüfung. Die Eigenerklärung stellt das auf den Kopf, indem die tatsächliche Prüfung der Eignung an den Schluss des Vergabeverfahrens gestellt wird. Es könnte also vorkommen, dass ein Auftraggeber ein Vergabeverfahren vollständig, einschließlich der Prüfung mehrerer Angebote durchführt, unter Umständen unter Beiziehung teurer externer Sachverständiger, um dann – nach Fassung der Zuschlagsentscheidung – darauf zu kommen, dass der vermeintliche Bestbieter etwa die erforderlichen Referenzprojekte nicht aufweist. Dann kippt dem Auftraggeber – besonders bei den zweistufigen Verfahrensarten und hier ganz besonders beim Verhandlungsverfahren – das ganze Vergabeverfahren. Dass damit das Einsparungsziel nicht erreicht wird, sondern volkswirtschaftlicher Schaden entsteht, liegt auf der Hand.
Die Prognose liegt daher nahe, dass die Auftraggeber wie schon bisher von Anfang an zumindest die wichtigsten Nachweise von vornherein werden sehen wollen und das so in den Ausschreibungsunterlagen regeln werden. Dass die Bieter, die ja die Nachweise sowieso bei der Hand haben müssen, nur deshalb die Ausschreibung anfechten, wird eher selten der Fall sein. So wird die unangefochtene Ausschreibung in diesem Punkt bestandfest – und alles bleibt, Eigenerklärung hin oder her, beim Alten.
Dr. Florian Keschmann, Rechtsanwalt
Foto: beigestellt (bearbeitet)
Redaktion: Walter J. Sieberer / Theresa Obermoser

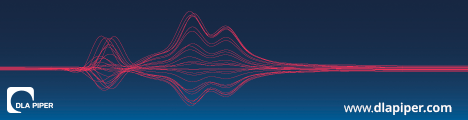









Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.