 STOLPER FALLEN DES ONLINE MARKETINGS .
STOLPER FALLEN DES ONLINE MARKETINGS .
Die Wiener Rechtsanwältin und Expertin für Online Marketing Dr. Bettina Windisch-Altieri zum Thema der Verwendung fremder Marken bei Keyword Advertising und der Speicherung von IP Adressen bei Analyse Tools
Der Bereich Online-Marketing ist nicht unmittelbar gesetzlich geregelt, sondern berührt verschiedensten Rechtsgebiete, zB das Markenrecht und das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Ebenso sind das E-Commerce-Gesetz und das Mediengesetz zu Fragen der Kennzeichnung von Werbung, der Impressumspflicht für Websites und zu Haftungsfragen angesprochen. Das Datenschutzgesetz und das Telekomgesetz spielen eine Rolle, wenn es um die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten geht.
Red.: Sind erfolgreiches Online-Marketing einerseits und der Schutz der Mitbewerber sowie der Internetuser andererseits ein Widerspruch? Wo besteht Handlungsbedarf?
Windisch-Altieri: Rechtlich ist vieles umstritten und noch in Entwicklung. Wir haben erst in den letzten Jahren Entscheidungen, die mit Online-Marketing zu tun haben, erhalten. Diese betreffen Fragen des Marken- und Wettbewerbsrechts beim Keyword Advertising (insb Google-Adwords); eine richtungsweisende Entscheidung des EuGH die Aufklärung bringen wird steht nun an, inwieweit das Buchen von fremden Marken als Keywords im Rahmen von Online-Werbung erlaubt ist. Zum Datenschutz beim Einsatz von Analysesoftware (zB Google-Analytics) gibt es erste Entscheidungen in Deutschland. Auch für Österreich ist eine Klärung herbei zu führen, ob IP-Adressen personenbezogene Daten darstellen und ihre Speicherung daher datenschutzrechtlich problematisch ist.
Red.: Worin liegen die konkreten Gefahren für Unternehmer und Internetuser bei der Verwendung von Tools wie Google-Analytics?
Windisch-Altieri: Google-Analytics und vergleichbare Analyse-Tools verfolgen die Bewegungen des Users auf einer aufgerufenen Website und speichern Informationen über Verweildauer, Aktivität oder Herkunft des Users usw. Einige Analyseprogramme erheben und speichern dabei die IP-Adressen der User; Google speichert die Daten dabei auf Servern in den USA. Dies ist aus Datenschutzgründen bedenklich. Die IP-Adresse identifiziert zwar im Regelfall noch nicht eine konkrete Person, zumal auch Privatpersonen zumeist gar keine fixe IP-Adresse haben; sie eröffnet jedoch die Möglichkeit, die ausgewerteten Daten mit dem konkreten Nutzer zu verknüpfen. Dies könnte Google in die Lage versetzen, ein persönliches Internetbewegungsprofil des Users zu erstellen. Wer Analysesoftware einsetzt, sollte sich daher genau erkundigen, welche User-Daten dabei erhoben und gespeichert werden. Um auf der sicheren Seite zu sein, sollten Webseitenbetreiber darauf achten, dass die eingesetzte Software ohne die Verwendung von IP-Adressen auskommt. Jedenfalls sollte auf der Website auf die Verwendung von Analysesoftware und die damit verbundene Datenverwendung deutlich hingewiesen werden und die Zustimmung des Users eingeholt werden.
Red.: Gibt es Entscheidungen zur Verwendung von Analyse-Tools?
Windisch-Altieri: In Deutschland gibt es bereits Entscheidungen, die sich mit der Frage der Zulässigkeit der Erhebung und Speicherung von IP-Adressen durch Analysesoftware befassten. Konkret ging es um Ansprüche der User auf Unterlassung und Löschung der Daten. In Berlin beurteilten die Gerichte IP-Adressen als personenbezoge Daten – ein Münchener Gericht war anderer Meinung. Die Frage ist in der deutschen Rechtsprechung
also noch umstritten. Höchstgerichtliche Entscheidungen bleiben abzuwarten. Die Tendenz geht aber dahin, dass IP-Adressen zu den personenbezogenen Daten zählen. In Österreich ist zum Filesharing höchstgerichtlich geklärt, dass die Provider Personendaten zu dynamischen IP-Adressen nicht speichern dürfen. Ob dies auf Analyse-Tools ebenso anwendbar ist, bleibt offen.
Red.: Thema Keywords. Ist es rechtlich problematisch, wenn ein Unternehmen Kennzeichen eines Mitbewerbers als Keyword einsetzt?
Windisch-Altieri: Bei der Gestaltung von Websites ist auf die Auswahl der Metatags zu achten. Von einer Verwendung von fremden Kennzeichen als Metatags im Quelltext der eigenen Website, ohne entsprechenden Information auf der Website, ist in jedem Falle abzuraten, da dies von der österreichischen Rechtsprechung als Markenverletzung angesehen wurde. Anders ist dies, wenn die Verwendung der Marke in den Metatags mit
dem sichtbaren Website-Inhalt im Zusammenhang steht, weil dann ein berechtigtes Interesse an der Benützung besteht und diese dem „Fair Use“ entspricht. Schaltet ein Unternehmen jedoch auch Online-Werbung so stellt sich die Frage, welche Keywords hier zulässig sind. Beim Keyword Advertising bucht der Werbetreibende beim Suchmaschinenanbieter Suchbegriffe, sogenannte Keywords und steuert so die Schaltung seiner Anzeige.
Gibt der User einen gebuchten Suchbegriff ein, so erscheint die Anzeige. Die Anzeige erscheint optisch getrennt oberhalb oder rechts von der Trefferliste und ist als „Anzeige“ gekennzeichnet. Umfassen diese Keywords nur
allgemeine oder beschreibende Begriffe, ist das unproblematisch. Verwendet das Unternehmen aber fremde Marken , so ist die Frage, ob das Keyword auf diese Weise beim Publikum Verwechslungen herbeiführen kann und daher Markenrechte verletzt. Erscheint dabei das fremde Kennzeichen in der geschalteten Werbeanzeige selbst, liegt eine Markenrechtsverletzung vor. Ob dies beim unsichtbaren Keyword, wenn also das Keyword nur die Platzierung der Anzeige steuert, ohne in der Anzeige aufzuscheinen, anders beurteilt wird, ist offen; dies insbesondere wenn die Anzeige räumlich getrennt oberhalb und neben der Trefferliste als Anzeige gekennzeichnet erscheint. Dies ist international Gegenstand zahlreicher Gerichtsverfahren. Der OGH hat diese Frage aus Anlass des „Bergspechte“- Falls dem EuGH vorgelegt; hier hat ein Veranstalter von Outdoor-Reisen den Namen eines Mitbewerbers als Keyword gebucht. Ein deutscher Parallelfall ging auch zum EuGH. Kurz gesagt: Keywords und Keyword-Optionen sind daher sorgfältig auszuwählen. Vorsicht ist dabei für Werbetreibende und Agenturen für die Buchung von Keywords und die Auswahl der Keyword- Optionen geboten. Markeninhaber können zu ihrem Schutz eigene registrierte Wortmarken bei Google derzeit noch sperren lassen. Hier ist daher jedenfalls die anwaltliche Beratung zu empfehlen.
Red.: Welche Verantwortung trifft Google und den Werbekunden?
Windisch-Altieri: Google kann nach Ansicht des OGH nur für Rechtsverletzungen seiner Kunden in Anspruch genommen werden, wenn solche offensichtlich sind. Google muss nach dieser Entscheidung daher ohne Abmahnung die Keywords seiner Kunden nicht auf Marken- oder Wettebewerbsverletzungen prüfen. Auch in Frankreich hat u.a. das Nobellabel Louis Vuitton Google geklagt, weil die Eingabe der Marke zu Webseiten von Anbietern gefälschter und verwechselbarer Waren führte. Das französische Höchstgericht hat die Frage, ob Google für solche Markenverletzungen verantwortlich sei, dem EuGH vorgelegt. Die nun vorliegenden Schlussanträge des Generalanwalts haben international für Aufsehen gesorgt, da er die Meinung vertritt, dass weder Google noch der Werbekunde Markenrechte verletze, wenn fremde Marken als Keywords gebucht würden. Zunächst ist das Angebot der Keywords nur zwischen Google und seinen Kunden und das Buchen einer Marke als Keyword daher kein markenmäßiger Gebrauch; dadurch würden noch keine Waren der Allgemeinheit angeboten. Aber auch die Verbindung, welche die Keywords zu den Websites andere Anbieter herstellen, stellt keine Markenverletzung dar. Den Internetnutzern sei bewusst, dass als Ergebnis einer Suchanfrage nicht nur die Website des Markeninhabers erscheine. Verwechslungsgefahr liege nicht vor, weil der Internetnutzer nur aufgrund des Inhalts der Anzeige und eines Besuchs der Website beurteile. Die aufgerufenen Websites seien oft absolut legal. Die Haftung von Google bestehe daher nur bei Vorliegen besonderer Umstände. Sofern die Anzeige in Google AdWords selbst jedoch Markenrechte verletze, hafte Google jedoch, so der Generalanwalt. Der Dienst Google Adwords sei ein entgeltlicher Dienst. Google habe daher Neutralität in Bezug auf die Angebote zu wahren. Die Schlussanträge sind für den EuGH jedoch nicht bindend.
Foto: © fotodienst/Anna Rauchenberger
Das Interview führte Mag. Walter J. Sieberer, publiziert in Anwälte für die Wirtschaft / Wirtschaftsblatt 25.11.2009

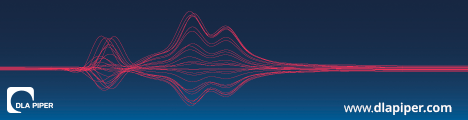

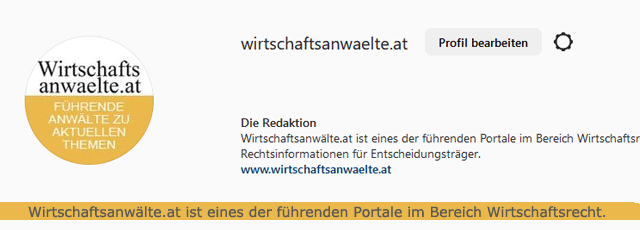



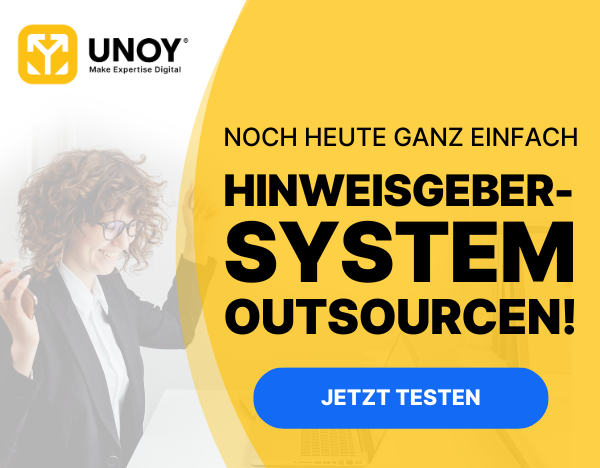



Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.