Am 7. Juli 2010 hat das Europäische Parlament den Novellierungsvorschlag („CRD III“) der Kommission vom 30. April 2009 für die Richtlinien 2006/48/EG – Bankrechtsrichtlinie – und 2006/49/EG – Kapitaladäquanzrichtlinie (gemeinsam, als „Capital Requirements Directive“ oder „CRD“ oder „Basel II“), ua im Hinblick auf die Vergütungspolitik im Finanzdienstleistungssektor, mit überwältigender Mehrheit angenommen.
Durch die Novellierung soll die Stabilität des Finanzsystems weiter gestärkt werden. Die CRD III wird voraussichtlich ab 1. Jänner 2011 in allen 27 Mitgliedstaaten in Kraft treten. In Österreich wird sie im BWG umzusetzen sein.
Damit hat das Europäische Parlament Regelungen für Vergütungssysteme (Bonus-Zahlungen, Gehälter und freiwillige Rentenzahlungen) an Bank-Manager zugestimmt, die sicher weltweit als eine der strengsten anzusehen sind. Diese Rahmenbedingungen sollen einen weiteren Beitrag zur Stabilisierung des Finanzsektors leisten. Das Hauptaugenmerk der CRD II ÄnderungsVerordnung liegt auf den variablen Vergütungskomponenten, von denen in Zukunft ein erheblicher Teil – zumindest 50% – unbar ausgezahlt werden soll.
Konkret geht es um folgende Vorgaben: Maximal 60% einer Bonus-Zahlung werden im Voraus zu zahlen sein, davon werden nur bis zu 30% in bar abgegolten, bei börsenotierten Kreditinstituten wird der Rest in Aktien oder Optionsscheinen (oder anderen gleichwertigen Beteiligungen) ausgegeben. Bei nicht börsenotierten Kreditinstituten besteht der unbare Anteil in mit Anteilen verknüpften Instrumenten oder gleichwertigen unbaren Instrumenten. Die restlichen 40% der Bonussumme unterliegen einer Rückstellungszeit von mindestens drei bis fünf Jahren, entsprechend dem Geschäftsgegenstand des Instituts, seinen damit verbundenen Risiken und der Tätigkeit des Mitarbeiters. Falls die Bonuszahlung besonders hoch ist, müssen 60% des Betrages zurückgestellt und dürfen nur bis zu maximal 20% in bar und im Voraus gezahlt werden. Die restlichen 20% werden in Aktien oder Aktienoptionsscheinen vergütet. Damit soll sichergestellt werden, dass die Auszahlung nur erfolgt, wenn es die Eigenkapitalausstattung des Finanzdienstleistungsunternehmen erlaubt und es im Hinblick auf seine langfristige Ertragsentwicklung vertretbar ist.
Bemerkenswert ist, dass es – entgegen der ursprünglichen Forderung des Europäischen Parlaments – keine gesetzliche Beschränkung hinsichtlich der Höhe von variablen Gehaltszahlungen (Bonuszahlungen), gemessen an den Fixgehältern, geben wird, sondern die Vergütungssysteme im Verhältnis zur Größe, internen Organisation und Komplexität der Finanzinstitute stehen sollen.
International abgestimmte Standards für „solide“ Vergütungspraktiken in der Finanzbranche (Principles for Sound Compensation Practices) sollen nun in nationales Recht der 27 Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Die EU hat dabei versucht, die Vorschläge der G20 und des Financial Stability Board (FSB) vom Herbst 2009 in einen rechtlichen Rahmen – auf die variablen Vergütungsbestandteile beschränkend – zu verpacken. Diese Bestimmungen lassen den nationalen Gesetzgebern einiges an Interpretationsspielraum offen.
Bereits seit 1. Jänner 2010 gelten in Österreich deutlich verschärfte Empfehlungen im Hinblick auf die Vergütung von Mitgliedern der Unternehmensleitung börsenotierter Unternehmen. Der österreichische Corporate-Governance-Kodex hat sich in seiner seit 1. Jänner 2010 geltenden Überarbeitung ausführlich mit dem Thema „Vorstandsvergütung“ auseinandergesetzt und die Empfehlung der EU-Kommission vom April 2009 bereits im Kodex berücksichtigt.
Die neuen Regelungen der Richtlinie zielen in Zukunft auf alle Institute, aber nicht auf alle Mitarbeiter ab. Es geht um Mitglieder der Geschäftsleitung und Mitarbeiter, deren Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil der Bank auswirkt („Risikokäufer“ und Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen) sowie um solche Mitarbeiter, die sich in einer ähnlichen Einkommenskategorie befinden wie die Geschäftsleitung und die Risikokäufer.
Von besonderer Bedeutung ist die Frage, ob bzw inwieweit die Richtlinie es gestattet oder gar verlangt, in bestehende Verträge einzugreifen. Wenngleich im Text betont wird, dass die Grundsätze des nationalen Arbeits- und Vertragsrechts unberührt bleiben sollen, wird klar das Problem der möglichen Umgehung durch den Abschluss nicht richtlinienkonformer Vereinbarungen im Umsetzungszeitraum gesehen. Dem möchte die Richtlinie so begegnen, dass davon auch Vergütungsvereinbarungen erfasst sind, die zwar vor der Umsetzung in nationales Recht geschlossen wurden, bei denen die Auszahlung im Umsetzungszeitpunkt aber noch nicht erfolgt ist oder die vor dem Umsetzungszeitpunkt geschlossene Vereinbarungen über die Abgeltung von Leistungen für das Jahr 2010 betreffen, sofern vor dem Inkrafttreten der nationalen gesetzlichen Vorschrift noch nicht ausgezahlt wurde. Darüber hinaus soll aber die variable Vergütung nur dann ausgezahlt werden, wenn sie angesichts der Finanzlage des Kreditinstituts insgesamt „tragbar“ sowie nach der Leistung des Kreditinstituts, des betreffenden Unternehmensbereiches und des betroffenen Mitarbeiters „gerechtfertigt“ erscheint. Nicht ganz klar ist, ob damit ein zusätzlicher, über die gerade geschilderte Regelung hinausgehender, Eingriff in bestehende Verträge legitimiert werden soll. Richtiger Weise wird der nationale Gesetzgeber wohl nur verhalten sein, für Fälle der fehlenden Vereinbarung der Auszahlung mit der Finanzlage des Kreditinstituts eine Aufschiebung der Auszahlung zu verfügen bzw der nationalen Aufsichtsbehörde entsprechende Rechte einzuräumen. Jedenfalls zweckmäßig, ja geboten, wird es sein, dass der nationale Gesetzgeber Kreditinstitute dazu verpflichtet, für die genannten Fälle in den Vereinbarungen mit den von der Richtlinie erfaßten Mitarbeitern entsprechende Zurückbehaltungs-, Kürzungs- oder auch Rückforderungsrechte zu verankern.
Unberührt von den neuen Bestimmungen sollen nach den Erwägungsgründen der Richtlinie anscheinend Kollektivverträge bleiben.
Die künftige Gestaltung von Arbeitsverträgen im Finanzdienstleistungssektor wird daher eine Herausforderung sein. Zu hoffen ist vorerst, dass der österreichische Gesetzgeber bei der Umsetzung der Richtlinie nicht – wie das leider immer wieder vorkommt, ja gerade auf diesem Rechtsgebiet fast zur Gewohnheit geworden ist – akribisch den Text abschreibt. Die Richtlinie eröffnet durchaus Gestaltungsspielräume, und wenn es um mögliche Eingriffe in die Privatautonomie geht, ist sorgfältige Vorgangsweise ein unbedingtes rechtsstaatliches Gebot. Jetzt schon zeichnet sich ab, dass die Branche (und zwar auf internationaler Ebene) auf die kommenden Regelungen durch Anhebung der Festbezüge reagiert. Das war in einer Marktwirtschaft nicht anders zu erwarten, wird aber von den Rechtsetzungsinstanzen auf europäischer Ebene offenbar bewusst in Kauf genommen. Denn es wird explizit gesagt, dass die festen Gehaltsbestandteile so hoch sein sollen, dass selbst ohne jede Auszahlung variabler Vergütungen eine angemessene Entlohnung sicher gestellt ist. Das was vor kurzem noch als geradezu rückständige Form der Entgeltgestaltung bei Managern galt (hohes Fixum und wenig Bonusphantasie) kehrt also nun unter der Flagge der Rettung des Finanzsektors vor einem erneuten Kollaps wieder. Man wird sehen, ob damit die Erwartungen nicht (deutlich) zu hoch geschraubt werden.
Dr. Georg Schima / Dr. Iris Jandrasits
Kunz Schima WallentinRechtsanwälte OG

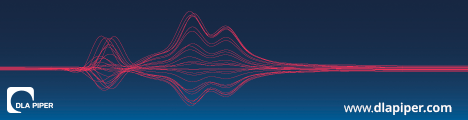











Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.